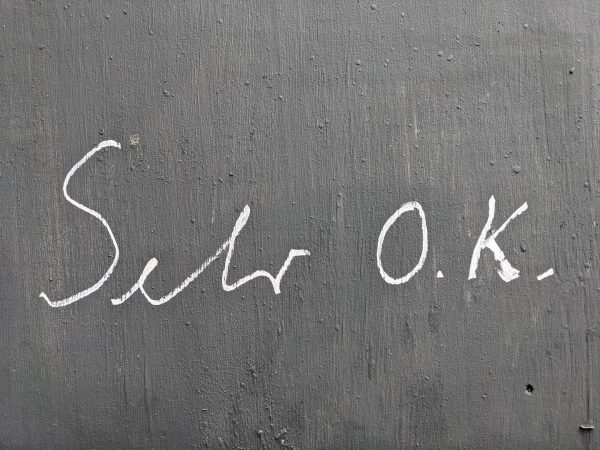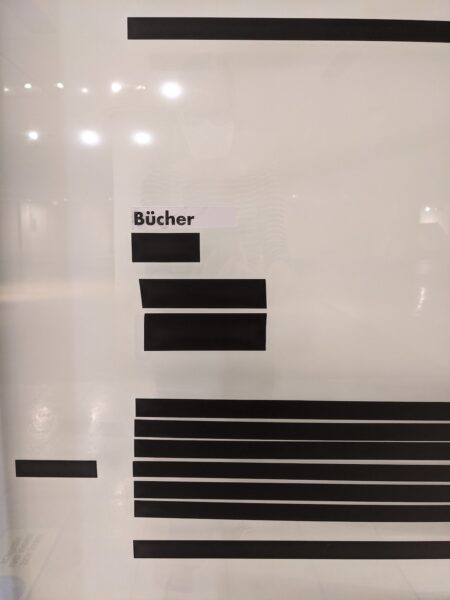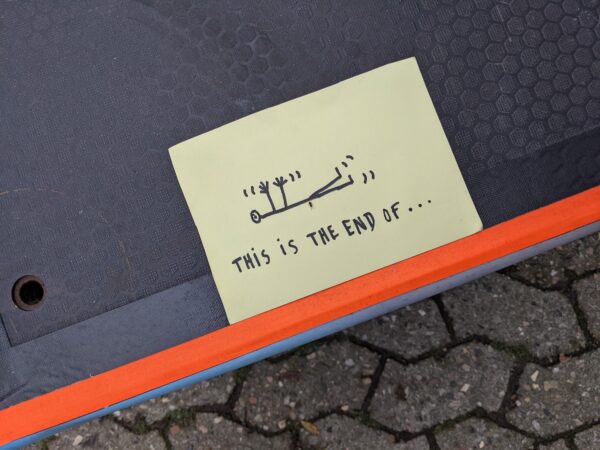Ich bin vorher schon zwei- oder dreimal in Wien gewesen, das letzte Mal vor über zwanzig Jahren. Wie die vorherigen Male war es damals eine Reise mit übersichtlichem Budget. Da fand ich Wien schon super. Wenn man aber ein etwas höheres Budget zur Verfügung hat und mitnehmen kann, wonach einem der Sinn steht, ist Wien noch viel superer. Denn günstig ist die österreichische Hauptstadt nicht. Zumindest nicht, wenn man im oder nahe des 1. Bezirks wohnen, Top-Sehenswürdigkeiten mitnehmen und in die Oper, ins Konzert und auch mal nett Essen gehen will. Dieses Mal wollte und konnte ich das alles – was für ein Luxus!
Die Reise bestand aus zwei Abschnitten: einer Studienfahrt und einem privaten Teil, wenn auch mit teils fließenden Übergängen. Zur Studienfahrt gehörten unter anderem Termine beim Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der FH Campus Wien, der OSZE und dem Bundesministerium für Landesverteidigung. Ein Mittagessen im und eine Führung durch das österreichische Parlament standen ebenfalls auf dem Programm.


Das historische Gebäude an der Ringstraße wurde 2018 bis 2022 umfassend saniert. Mit der Sanierung war eine weitgehende Öffnung des Hauses verbunden. Seither gibt es neben Führungen ein noch umfassenderes Angebot zur Demokratiebildung, einen Ausstellungs- und Erlebnisbereich („Demokratikum“) und einen Parlamentsshop; das Volk kann in der Parlamentsgastronomie essen und in der Parlamentsbibliothek lernen und arbeiten. Man darf im Rahmen einer Führung sogar in den Sälen des National- und des Bundesrates auf den Stühlen Platz nehmen (ich weiß jetzt, wie ein österreichischer Vizekanzler sitzt). Nur die Bestuhlung des historischen Sitzungssaals bleibt abgesperrt, um die ebenfalls historische Möblierung zu schützen. Er wird überhaupt auch nur bei besonderen Anlässen verwendet, zum Beispiel, wenn die Bundesversammlung zusammentritt.

Mich hat das Gebäude, vor allem aber die Offenheit des Gebäudes tief beeindruckt. Ja, ich weiß, den Reichstag in Berlin kann man auch besuchen, ich war selbst mehrfach dort. Aber ein offenes Haus im österreichischen Sinne ist der Bundestag nicht.
Was unbestritten zum Flair der Stadt gehört und in jedem Reiseführer Erwähnung findet ist die berühmte Wiener Kaffeehauskultur. So richtig konnte ich mich damit bisher nicht anfreunden. Ich bin an sich keine Kaffeehaussitzerin; ich kaufe meinen Kuchen gerne „to go“ und fläze mich damit aufs Sofa.

In Wien könnte ich mir das Kaffeehaussitzen aber glatt angewöhnen. Diese ganz spezielle Atmosphäre des In-Gesellschaft-in-Ruhe-gelassen-werdens hat schon ihren Reiz. Ich testete unter anderem das Café Museum, das Café Leopold Hawelka und das Café Prückel und obwohl ich im Museum den wahrscheinlich besten Apfelstrudel meines bisherigen Lebens genießen durfte, hat das Prückel mein Herz erobert. Im Keller gibt es sogar ein Theater!

Wo war ich noch? In der Österreichischen Nationalbibliothek natürlich. Neben dem ganz normalen Bibliotheksbetrieb gehören zu dieser fünf verschiedene Museen sowie das Haus der Geschichte Österreichs. Ich entschied mich für das Globenmuseum im Palais Mollard und den barocken Prunksaal. Beides sehr empfehlenswert.


Falls ich künftig in die Verlegenheit kommen sollte, den Begriff „barockes Gesamtkunstwerk“ erklären zu müssen, werde ich einfach immer auf dieses Bauwerk verweisen. Wahnsinn! Nur die Sonderausstellung hat mir nicht gefallen. Beziehungsweise, dass es dort überhaupt Sonderausstellungen gibt. Der Star ist doch der Saal, da wirkten die Exponate irgendwie störend.
Zum Thema Reisebudget sei erwähnt, dass der reguläre Eintritt in das Kunsthistorische Museum stolze 21 (in Worten: einundzwanzig) Euro kostet. Dafür kann man aber auch überall hin. Zumindest theoretisch, denn Richtung Gastronomie bildete sich bald eine beeindruckende Schlange und ohne reservierten Timeslot waren die Chancen auf einen Blick in die Rembrandt-Sonderausstellung äußerst gering. Weil diese Option ausgebucht war, schloss ich mich spontan einer Führung an. Dafür musste ich zwar noch einmal zehn Euro auf den Tisch legen. Dafür kam ich aber mit der Gruppe an der Schlange vorbei in die Ausstellung und in den Genuss kompetenter Erläuterungen. Davon bin ich bei bildender Kunst nämlich abhängig, wenn es mir jenseits des bloßen Konsums darum geht, zu verstehen und einzuordnen. Hat sich gelohnt in diesem Fall.

Vorher hatte ich noch Gelegenheit, mich in der Kunstkammer umzusehen. Die Kunstkammer Wien beherbergt historische Sammlungen adeliger und königlicher Persönlichkeiten und gilt als Wiege des heutigen Museums. Es fällt schwer, unter den vielen spektakulären Objekten einen Favoriten zu küren, aber mir ist es gelungen!

Das ist ein Automat in Form einer Galeone von Hans Schlottheim, datiert auf das Jahr 1585. Hier kann man das gute Stück in Aktion erleben:
Fehlen noch die beiden musikalischen Höhepunkte der Reise. Ins Haus des Musikvereins trieb mich hauptsächlich, dass ich gerne einmal ein Konzert im Goldenen Saal besuchen wollte. Das ist der Saal, in dem die Wiener Philharmoniker das alljährlich in zig Länder übertragene Neujahrskonzert spielen. Die Philharmoniker passten leider nicht ins Programm, aber dafür das ORF RSO Wien unter der enthusiastischen Leitung von Maxime Pascal und mit Truls Mørk als Solist am Violoncello.

Gegeben wurden Werke von Arnold Schönberg, Henri Dutilleux und Claude Debussy sowie eine Solistenzugabe von Benjamin Britten. Das hat mir ausnehmend gut gefallen. Schade, dass das Konzert nicht ausverkauft war. Richtig gut ist, dass man in den vorderen Parkett-Logenplätzen auf Höhe des Bühne sitzt. Man hat dadurch noch mehr als in anderen Häusern das Gefühl, Teil des Orchesters zu sein. Der Platz war auch gar nicht so teuer – ok, schon teuer, aber nicht absurd teuer.
Ganz andere Preise werden dagegen in der Wiener Staatsoper aufgerufen. Schon die Führungen schlagen mit 15 Euro zu Buche. Dafür sind sie generalstabsmäßig organisiert und in mindestens fünf Sprachen verfügbar. Wenn man eine Aufführung besucht und nicht nur hören, sondern auch etwas sehen möchte, sollte man am Eintrittspreis dennoch nicht sparen. Günstige Tickets gibt es auch – ich habe auf solchen Plätzen schon gesessen – aber dann ist es halt mehr Hörspiel als Oper.

Diesen Blick von der Mittelloge habe ich aber auch nur bei der Führung dokumentieren können.

Die Aufführung – Giuseppe Verdis „Macbeth“ in der 2020er Inszenierung von Barrie Kosky – habe ich aus einer Perspektive ein Stockwerk höher und etwas seitlicher gesehen. Dabei führte das Hauspersonal ein strenges Regiment, unter anderem mit sehr klaren Ansagen bezüglich Handynutzung und Geräuschvermeidung. Das hat entscheidend zu einem weitgehend ungetrübten Operngenuss beigetragen und fand daher meine volle Unterstützung. Gerald Finley und Anastasia Bartoli als Macbeth und Lady Macbeth haben mich nicht nur gesanglich, sondern vor allem darstellerisch überzeugt. Ich mochte die düstere Inszenierung mit dem sehr reduzierten Bühnenbild, nur die merkwürdige Nude-Kostümierung des (Bewegungs-)Chors hat mir nicht zugesagt. Zum Raum: Was für eine phänomenale Akustik! Und was für ein geniales Über- beziehungsweise Untertitelsystem! An jedem Platz, auch den Stehplätzen, gab es kleine Displays, auf denen es Informationen zum Programm in zwei und Untertitel in acht Sprachen zu lesen gab. Gesehen hat man dabei nur den eigenen Bildschirm und wenn man gewollt hätte, hätte man das Teil auch einfach eingeklappt und ungenutzt lassen können. Großartig. Wann gibt es das in Hamburg?

Aus dieser Wien-Reise hätte ich gut und gerne eine mehrteilige Rückschau schnitzen können, ähnlich wie ich es mit meinen Besuchen in London getan habe. Aus Zeitgründen verzichte ich dieses Mal darauf. Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen und mehr Muße für die Nachbereitung im Anschluss.